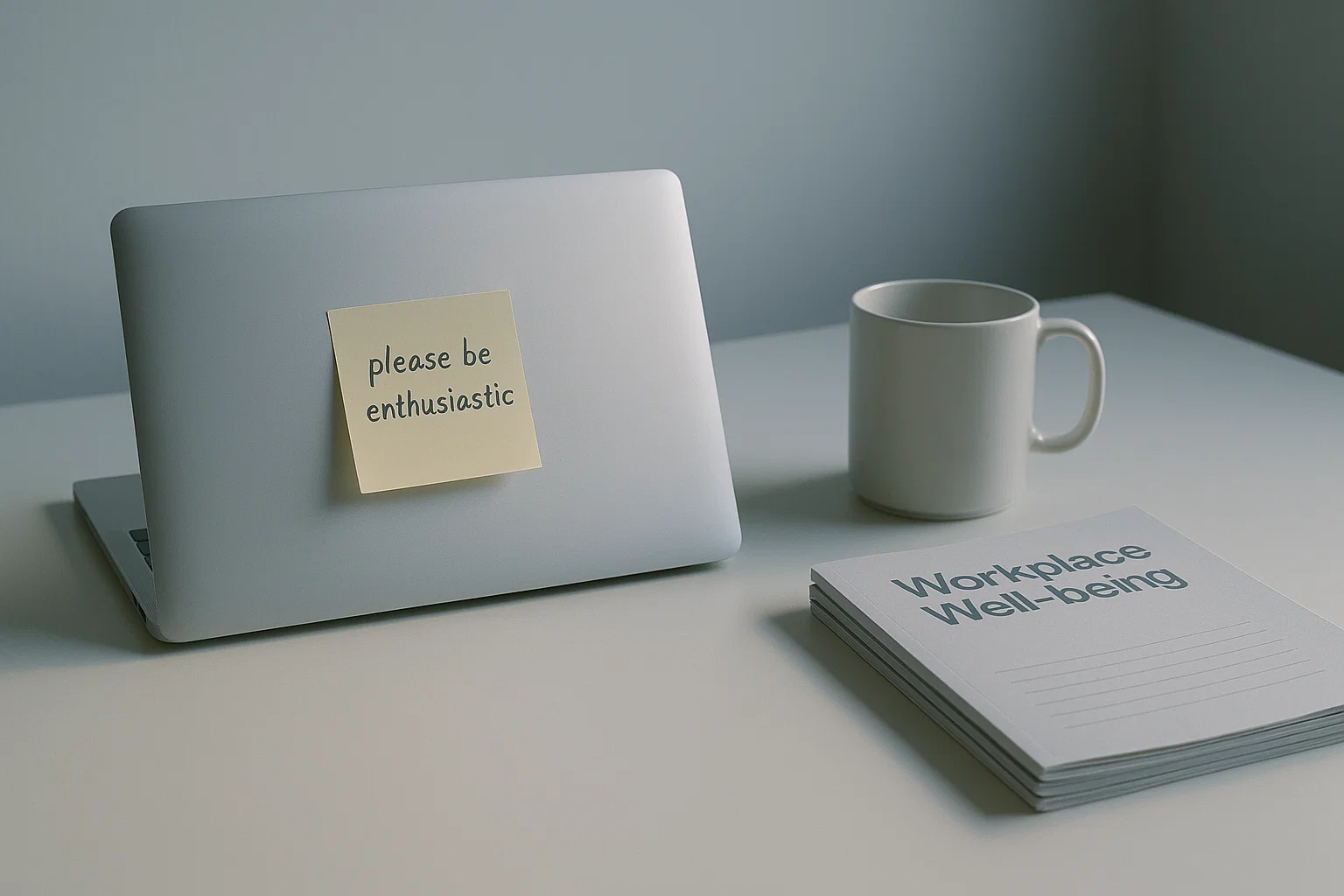
◫ JOPS – ZZ Paper 3
The Archival Burden of Feelings
Eine qualitative Analyse affektiver Restbestände in bürokratischen Systemen
Abstract
In dieser Studie wird untersucht, wie Organisationen versuchen, Emotionen ihrer Mitarbeitenden zu erfassen, zu kanalisieren oder zu neutralisieren – und warum all diese Bemühungen systematisch scheitern. Basierend auf einer multi-site Analyse von Meetingprotokollen, Umfragen, internen Kommunikationsrichtlinien und alltäglichen Büropraktiken zeigt sich ein konsistentes Muster: Gefühle werden als „Störfaktoren“ begriffen, die verwaltet, kategorisiert oder in harmlose Formen überführt werden müssen.
Diese Studie entwickelt den Begriff der affektiven Restbestände: jene emotionalen Rückstände, die nach dem organisatorischen Versuch, Ambivalenzen zu glätten, in Systemen zurückbleiben. Dazu zählen ironische Zustimmung, verdeckte Erschöpfung, stille Verzweiflung, performative Zuversicht und das weit verbreitete Phänomen der „freundlichen Resignation“.
Die Analyse legt offen, dass institutionelle Versuche, Gefühle messbar zu machen — etwa durch Zufriedenheitsumfragen, Stimmungs-Ampeln, Check-ins, Feedback-Skalen oder Doodle-Kommentarfelder — weniger der emotionalen Realität dienen als der Aufrechterhaltung eines Narrativs: Alles ist unter Kontrolle. Alles ist gut. Wir sind eine Familie.
Das zentrale Paradoxon dieser Befunde: Während Organisationen versuchen, affektive Komplexität zu reduzieren, produzieren sie unfreiwillig neue Formen emotionaler Überforderung. Die Ergebnisse zeigen, dass Emotionen weder in Tabellen, noch in Leitfäden, noch in institutionalisierten Ritualen verschwinden, sondern sich in versteckten Affektökonomien sammeln, wo sie neue Bedeutungen annehmen.
Diese Studie argumentiert, dass das Management von Gefühlen nicht primär ein ethisches oder psychologisches Problem ist, sondern ein epistemisches: Systeme, die emotionales Leben katalogisieren wollen, produzieren zwangsläufig blinde Flecken. Und genau in diesen blinden Flecken beginnt das Eigentliche.
Methodik
Die vorliegende Studie folgt einem multiperspektivischen Design, das darauf abzielt, affektive Prozesse in institutionellen Kontexten nicht als psychologische Phänomene, sondern als administrative Artefakte zu analysieren. Die Methodik kombiniert dokumentarische Analyse, teilnehmende Beobachtung und die Rekonstruktion affektiver Signale aus organisationalen Nebenprodukten.
Im Zentrum stehen drei Datenquellen:
- Affektprotokolle:
informelle Gesprächsnotizen, E-Mail-Formulierungen, Tonlagen in Teammeetings sowie institutionelle Phrasen mit hohem emotionalen Verdichtungsgrad (z. B. „wir verstehen, dass dies eine intensive Zeit ist“). - Ambivalenzartefakte:
Zufriedenheitsumfragen, Doodle-Kommentare, anonyme Feedbackfelder, Jubiläumskarten sowie jegliche organisationalen Rituale, die Gefühle voraussetzen, aber nicht adressieren. - Restbestandsdaten:
jene affektiven Rückstände, die nach strukturellen Konflikten, Ressourcenengpässen oder performativer Harmonieproduktion im System verbleiben (z. B. Müdigkeitsantworten im Smalltalk, fluchtartige Gangwechsel, stumme Mikro-pausen in Sitzungen).
Die Auswertung erfolgte in zwei Schritten:
- Emotionales Pre-Processing:
Die extrahierten Aussagen wurden in drei Kategorien überführt: freundliche Resignation, performative Zuversicht und administrierte Ambivalenz. Alle nicht zuordenbaren Datenpunkte wurden als affektive Restbestände klassifiziert. - Affektökonomische Rekonstruktion:
Die Kategorien wurden hinsichtlich ihrer Funktion im institutionellen Gleichgewicht analysiert. Methodisch orientiert sich dieser Schritt an einer modifizierten Form der Grounded Theory, bei der nicht nach Wahrheit, sondern nach Energieflüssen gesucht wird. Dies ermöglicht die Identifikation jener Stellen, an denen Gefühle administrativ abgefangen, umgeleitet oder neutralisiert werden.
Statistische Modelle wurden nicht angewendet, da Gefühle in Tabellen ohnehin nur als Rauschen erscheinen. Stattdessen wurde eine qualitative Restbestandsanalyse genutzt, die darauf abzielt, was übrig bleibt, wenn alles andere optimiert wurde, sichtbar zu machen.
Ergebnisse (Auszug)
1. Administrative Empathie – Das Ritual des vorsichtigen Bedauerns
In allen untersuchten Fällen zeigte sich ein identisches Muster: Belastungen werden formal anerkannt („wir verstehen, dass dies eine intensive Zeit ist“), jedoch ohne strukturelle Konsequenz. Die Aussage fungiert als affektive Beruhigungsgeste, nicht als Handlungsimpuls. Mitarbeitende berichten, dass dieser Satz seit Jahren unverändert im Umlauf ist, unabhängig von Kontext, Arbeitsvolumen oder Teamzustand. Die Folge ist eine Form der freundlichen Resignation: das Gefühl, gehört zu werden, ohne dass das Gehörte eine Bedeutung hat.
2. Die Normierung der Zufriedenheit – Affekt als Compliance-Indikator
Zufriedenheitsumfragen dienen weniger der emotionalen Lageeinschätzung als der Stabilität eines gewünschten Organisationsbildes. Abweichungen vom erwarteten Mittelwert werden als Auffälligkeiten markiert, die durch Teamleitungen korrigiert werden sollen. In mehreren Fällen wurde dokumentiert, dass konstruktive Kritik durch moralische Appelle („sei dankbar für deinen Job“) entschärft oder umgedeutet wurde. Die Umfrage wird dadurch zu einem Instrument der affektiven Normangleichung, nicht der Erkenntnisgewinnung.
3. Affective Drift in Monday Meetings – Wenn Ehrlichkeit als Fehlfunktion gilt
Die Frage „Wie geht’s?“ erfüllt in institutionellen Kontexten primär eine rituelle Funktion. Ehrliche Antworten („müde“, „erschöpft“, „überfordert“) führen regelmäßig zu Kommunikationsabbrüchen oder halbautomatischen Umleitungen („ah ja, mir auch gut…“). Dieser affektive Drift zeigt, dass nicht die Gefühle selbst zu viel sind, sondern ihre Unsicherheit: Das System kann mit Ambivalenz nicht arbeiten und bevorzugt daher die Stabilität der Skriptreplikation.
4. Burnout als Kulisse – Die Ästhetisierung der Erschöpfung
In mehreren untersuchten Fällen zeigte sich, dass kollektive Überlastung zum Normalzustand geworden ist, ohne als strukturelles Signal anerkannt zu werden. Obwohl bis zu zwei Drittel eines Teams Symptome von Erschöpfung zeigen, werden zusätzliche Aufgaben erwogen, sofern sie „ein gutes Bild im Jahresbericht abgeben“. Die rhetorische Formel „wir wissen, dass ihr viel zu tun habt… aber…“ fungiert als moralische Vorrede zur Intensivierung der Belastung. Burnout wird dadurch nicht als Risiko betrachtet, sondern als kulissenhafte Ressource, die das Narrativ von Engagement und Aktivität stützt.
5. Das Jubiläumsparadox – Zuneigung als Verwaltungsakt
Jubiläen werden häufig durch handschriftliche Postkarten markiert, deren Absender:innen den Empfänger:innen nicht persönlich bekannt sind. Diese Praxis erzeugt eine paradoxe Stimmung: ein Gefühl der institutionellen Nähe, das gleichzeitig auf Distanz basiert. Die Geste soll Bindung erzeugen, hinterlässt jedoch häufig „unspezifisches Unbehagen“ und das diffuse Empfinden, in eine Beziehung verwickelt zu sein, die nur verwaltungstechnisch existiert.
6. Die Fehlinterpretation des Rückzugs – Intrusionsdruck in sozialen Mikroräumen
Die Beobachtung zeigt ein konsistentes Muster: Rückzugssignale werden institutionell häufig als Einladung zur Annäherung interpretiert. Eine Person versucht, eine Situation zu verlassen; eine zweite Person ruft hinterher: „Heeyyy, ich habe dich so lange nicht mehr gesehen!“ Diese Fehlinterpretation verweist auf ein systemisches Defizit im Erkennen von Ambivalenz und führt zu erhöhter sozialer Übergriffigkeit in Mikrointeraktionen. Rückzug wird dadurch nicht als Bedürfnis, sondern als Kommunikationsfehler betrachtet.
7. Performative Zuversicht – Die Jahresansprache als affektive Choreografie
Leitungsansprachen folgen einer wiederkehrenden Struktur: Die institutionelle Lage wird als „ausgezeichnet“ beschrieben, gefolgt von der Ankündigung, im kommenden Jahr „noch mehr“ zu leisten – bei unveränderten Ressourcen. Diese Form der performative Zuversicht verdeckt strukturelle Grenzen und produziert ein affektives Klima, in dem Widerspruch als Illoyalität gelesen wird. Emotionale Realität wird zur Dekoration des Fortschrittsnarrativs.
Diskussion – Die institutionelle Verwaltung des Unaussprechlichen
Die vorliegenden Befunde legen nahe, dass institutionelle Versuche, Emotionen zu adressieren, weniger der affektiven Realität der Mitarbeitenden dienen als der Stabilisierung organisationaler Selbstbilder. Gefühle werden nicht als Hinweise verstanden, sondern als Störungen im Ablauf; sie sollen nicht gehört, sondern eingeordnet werden.
Zentral ist dabei das paradoxe Zusammenspiel von formaler Anerkennung und faktischer Entwertung:
Belastung wird benannt, aber nicht bearbeitet;
Kritik wird eingeladen, aber neutralisiert;
Ehrlichkeit wird abgefragt, aber als Abweichung gedeutet.
Diese Praktiken erzeugen eine doppelte Struktur: Ausdruck wird gefordert,
Affekt jedoch systematisch begrenzt.
Die Analyse der Daten zeigt, dass Organisationen eine Präferenz für affektive Klarheit entwickeln – eine Art emotionales Monochrom, das weder Ambivalenz noch Tiefe zulässt. Unsicherheit wird als Risiko interpretiert, obwohl sie in der Praxis ein natürlicher Bestandteil menschlicher Arbeit ist. Stattdessen entsteht eine Kultur der affektiven Glättung: ein Zustand, in dem alles gerade so harmonisch wirkt, dass nichts in Bewegung geraten muss.
Dieses Glätten emotionaler Realitäten hat jedoch systemische Nebenwirkungen. Werden Gefühle nicht in ihrer Komplexität verstanden, sammeln sie sich als affektive Restbestände:
Müdigkeit, die nicht ausgesprochen werden darf;
Frustration, die als Undankbarkeit gilt;
Nähegesten, die Distanz erzeugen;
Zuversicht, die zur Pflicht wird.
Gefühle verschwinden nicht – sie wechseln lediglich den Aggregatzustand.
Die institutionelle Blindheit entsteht daher nicht aus böser Absicht, sondern aus einer epistemischen Begrenzung: Systeme, die affektive Komplexität katalogisieren wollen, können nur das wahrnehmen, was sich in Tabellen eintragen lässt. Alles andere fällt durch die Raster und wird im informellen Raum abgelegt: in Blicken, in Mikro-Pausen, in fluchtartigen Gangwechseln, in ironischen Doodles, in jenen kurzen Momenten, in denen ein „mir geht es gut“ nicht lang genug hält.
Die hier beschriebenen Dynamiken zeigen, dass das Problem weniger im Umgang mit Gefühlen liegt, als in der institutionellen Vorstellung davon, was Gefühle sein sollten. Nicht die Emotionen sind das Risiko – sondern die Annahme, dass sie sich verwalten, normieren oder aus dem Organisationsalltag herauskurieren lassen.
Abbildung 2. Affective Residue Map – Verteilung affektiver Restbestände
Hinweis: Daten wurden bereinigt, um Irritationen im Management zu vermeiden.
Empfehlungen für die Praxis – Prototypen eines gefühlskompatiblen Betriebsklimas
Auf Grundlage der vorliegenden Metaanalyse schlagen wir Maßnahmen vor, die das institutionelle Bedürfnis nach Stabilität respektieren, ohne die affektive Realität der Mitarbeitenden unnötig zu berühren. Die Empfehlungen wurden so gestaltet, dass sie strukturelle Veränderung weder erzwingen noch verhindern – sondern höflich umkreisen.
1. Einführung des „Emotional Baseline Protocol“ (EBP)
Jede Woche wird eine institutionell definierte Grundstimmung (z. B. „optimistisch erschöpft“) kommuniziert. Mitarbeitende dürfen davon abweichen, müssen dies jedoch nicht deklarieren. Ziel ist die Harmonisierung kollektiver Affekt-Erwartungen, ohne den Aufwand echter Kommunikation.
2. Implementierung eines „Gefühls-Korridors“
Analog zu Temperaturbereichen in Serverräumen wird ein affektiver Toleranzbereich festgelegt (z. B. ±15 % Müdigkeit, ±10 % Frustration). Zustände außerhalb des Korridors gelten als „methodisch nicht verwertbar“ und werden zu statistischem Rauschen erklärt.
3. Einführung des „Silently Overwhelmed Badge“
Ein kleines, unauffälliges Symbol am Laptop, das signalisiert: „Ich bin heute freundlich, aber bitte nicht in mein Nervensystem greifen.“ Das Badge schafft Raum für Grenzziehung, ohne dass jemand darüber sprechen muss.
4. Einrichtung einer „Abteilung für kuratiertes Enthusiasmus-Management“
Diese Einheit ist verantwortlich für die präzise Dosierung institutioneller Begeisterung. Sie achtet darauf, dass Ankündigungen nicht länger als 27 Sekunden euphorisch wirken und dass Teammitglieder nicht erneut applaudieren müssen.
5. Quartalsweise Durchführung eines „Emotional Load Forecast“
Nach dem Modell meteorologischer Vorhersagen wird berechnet, wie viel Belastung das System in den kommenden Monaten vermutlich erzeugen wird. Prognosen dürfen ignoriert werden, solange sie in PowerPoint gut aussehen.
6. Optional: Einführung einer „Recovery Hour“
Eine Stunde pro Woche ohne Meetings, Mails oder Teams-Notifications, offiziell als Regeneration gedacht, inoffiziell als Zeitfenster für Menschen, die versuchen, überhaupt erst herauszufinden, wie sie sich fühlen.
7. Empfehlung zur Nicht-Empfehlung
Alle folgenden Maßnahmen gelten als implementiert, sobald sie kommunikativ erwähnt wurden. Die tatsächliche Durchführung ist aus Gründen der psychischen Sicherheit bis auf Weiteres ausgesetzt.
Schlussfolgerung
Institutionen sind nicht gefühlskalt – sie sind gefühlsüberfordert. Hinter jeder Richtlinie, jedem Meeting und jeder empathischen Floskel zeigt sich der Versuch, das Unmessbare zu verwalten: menschliche Stimmung, Veränderungsdruck, die Angst vor Bedeutungsverlust.
Die vorliegende Analyse zeigt, dass affektive Praktiken nicht Nebenprodukte organisationaler Kultur sind, sondern deren unsichtbare Steuerungslogik. Die wirkliche Frage lautet daher nicht, „Wie fühlen Mitarbeitende?“ sondern: „Welcher Teil ihres Fühlens ist institutionell anschlussfähig?“
Vielleicht beginnt echte Transformation nicht in neuen Konzeptpapieren, sondern im Moment, in dem eine Organisation bemerkt, dass sie nicht nur Prozesse, sondern Menschen verwaltet – und dass Menschen nicht im Governance-Korridor funktionieren.
Keine Policy und kein Kader wurden bei dieser Studie verletzt;
lediglich ein Restbestand an Empathie wurde leicht angekokelt.