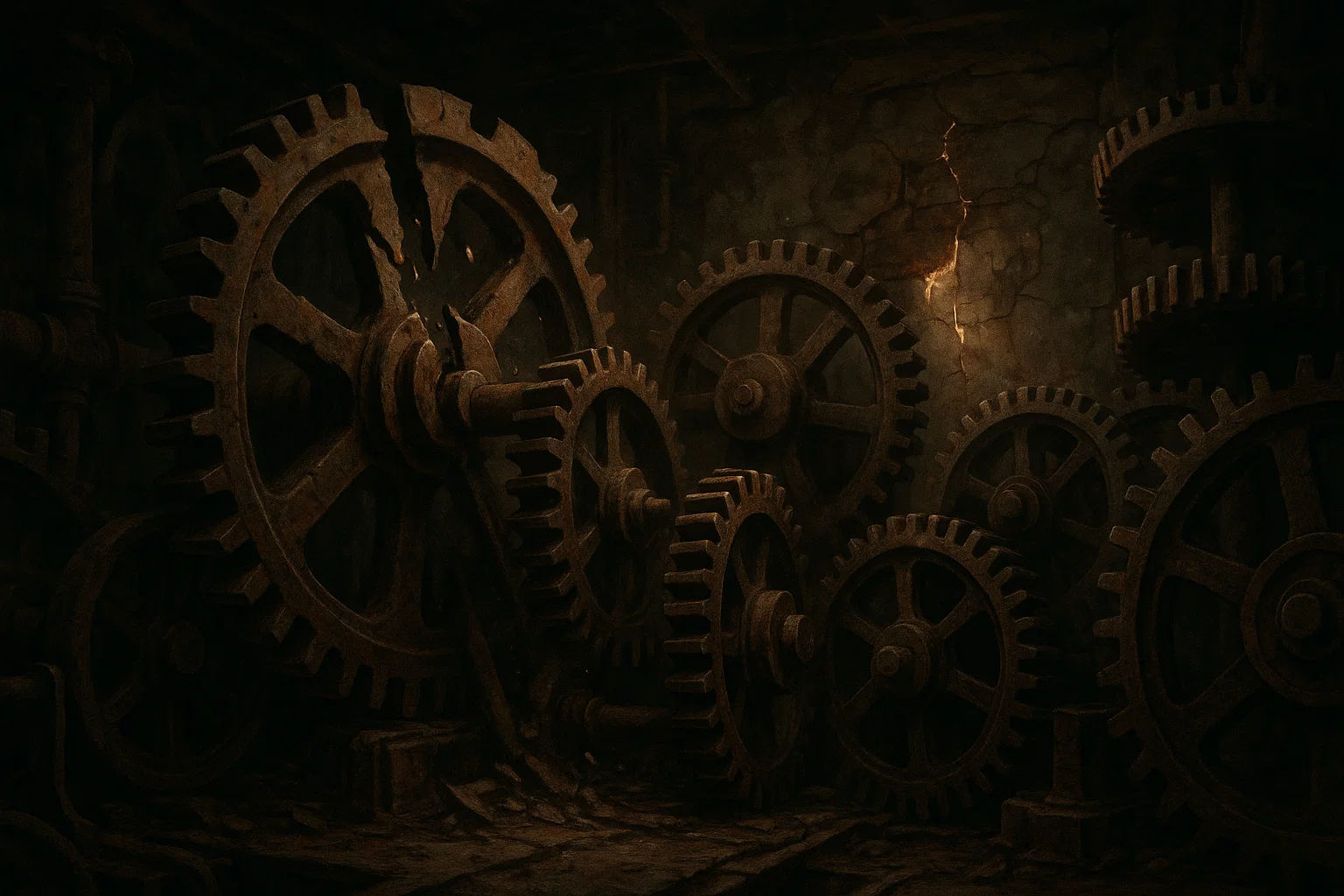
Stille Richtlinie 42 – ein Memo aus der Parallelverwaltung
Ein Versuch, inneren Kollaps zu denken, bevor er einfach passiert.
„Wir haben festgestellt, dass viele Anträge gar nicht gestellt werden –
weil niemand wusste, dass sie erlaubt wären.“
Vermerk 42/b – zur internen Zirkulation
Abteilung für Zutrauen, Resonanz und Wiederannäherung
vormals: Stabsstelle Effizienz & Kontrolle (aufgelöst)
Betreff:
Verwaltungsrichtlinie zur stillen Anerkennung innerer Erschöpfung
Inhalt (gekürzt):
- Personen, die keine Diagnose haben, aber trotzdem nicht mehr können, dürfen dies fortan als Zustand deklarieren.
- Für jene, die nie gelernt haben, um Hilfe zu bitten, gilt implizite Antragsannahme.
- Die Kategorie „Zweifel“ wird in Zukunft nicht mehr als Schwäche klassifiziert, sondern als Eintrittspunkt für Beziehung.
- Rückzüge, Funkstille und Desorientierung gelten in Version 4.2 nicht mehr als Störung, sondern als Hinweis auf Systemlast.
Hinweis an alle Sachbearbeiter:innen:
Ein Mensch, der still wird, tut das nicht immer freiwillig.
Fußnote:
Wir bitten um vorsichtige Anwendung im laufenden Betrieb.
Diese Richtlinie wurde nicht überarbeitet, sondern gefühlt.
Nicht jeder braucht sofort Hilfe.
Aber jede Person verdient es, gesehen zu werden, bevor sie zusammenbricht.
Simulation 1: RICHTLINIE 42_light.exe
Die Utopie einer Parallelverwaltung, einer „Richtlinie 42“, in der Zutrauen vor Kontrolle steht, ist schnell gedacht. Und genauso schnell abgetan: „Naiv, unfinanzierbar, realitätsfern.“
Okay. Stimmt. Lassen wir die Utopie fallen.
Stattdessen starten wir eine Simulation. Ein kleines Gedankenspiel mit nur einer einzigen neuen Regel im System. Sehen wir zu, was passiert.
🎮 SIMULATION START
Variable:
Jede Person im System erhält einen einzigen, anonymen, nicht nachverfolgbaren Knopf mit der Aufschrift: „Pause. Ich kann gerade nicht mehr.“
Es gibt keine Konsequenzen. Keine Fragen. Kein Stigma. Nur eine anerkannte Pause. Für einen Tag, eine Woche, einen Monat. Das System muss es einfach kompensieren.
Erwartetes Ergebnis (laut Abteilung „Optimismus“):
Menschen nutzen die Pause, regenerieren, kommen motivierter zurück. Die Produktivität steigt langfristig. Ein Sieg für die Menschlichkeit.
Simuliertes Ergebnis V1.0 (laut Abteilung „Realität“):
- Tag 1: 15 % der Belegschaft drücken den Knopf. Man spricht von einer „unerwarteten Grippewelle“. Die Verbliebenen fangen es auf, Stimmung: angespannt-solidarisch.
- Tag 7: 40 % sind im Pausenmodus. Projekte stocken. Die ersten Teams fallen aus. Die „Gesunden“ beginnen, die „Pausierer“ zu beneiden und zu verfluchen.
- Tag 30: 70 % Ausfall. Lieferketten brechen. Kernfunktionen sind offline. Die, die noch da sind, sind jene, die Angst haben, unentbehrlich zu sein – oder deren Job so sinnlos ist, dass ihre Abwesenheit nicht auffällt. Solidarität ist tot. Kollaps.
SIMULATION BEENDET
Analyse 1: Was diese Simulation zeigt
Die Simulation ist gescheitert. Nicht, weil die Menschen „faul“ wären. Sie ist gescheitert, weil das System nie auf die ehrliche Antwort seiner Teilnehmer ausgelegt war.
Die harte Wahrheit, die kein Effizienz-Berater aussprechen will:
Unsere Stabilität basiert nicht auf der Stärke des Systems,
sondern auf unserer Unfähigkeit, „Stopp“ zu sagen.
Unsere Wirtschaft läuft nicht auf Kerosin. Sie läuft auf der Energie, die wir aufbringen, um unseren eigenen Zusammenbruch zu administrieren. Darauf, dass abends die Kraft für den Ausstiegsplan fehlt.
Dieses Gedankenspiel wollte keine Utopie bauen. Es wollte nur wissen, was passiert, wenn wir den einen Schalter umlegen, der „Ehrlichkeit“ heißt.
Die Frage ist also nicht:
„Wie können wir uns eine menschlichere Welt leisten?“
Die Frage ist:
Wie lange hält ein System, das sich Menschlichkeit aktiv nicht leisten darf,
weil es sonst aufhört zu existieren?
🎮 SIMULATION START: Drückst du den Knopf?
Fußnote:
Die Simulation ist nur ein Spiel. Der Systemfehler nicht.
Nicht jeder Kollaps kommt mit einem lauten Knall.
Manchmal klingt er wie tausendfaches, stilles Klicken.
Simulation 2: RICHTLINIE 42_stay.exe
Wir simulieren weiter und fragen: Wer trägt eigentlich das System, wenn die Ehrlichen pausieren?
Die Simulation RICHTLINIE 42_light.exe zeigt den Kollaps: 70 % drücken „Pause“, das System bricht. Aber was ist mit den 30 %, die bleiben?
Lassen wir die Utopie. Starten wir eine neue Runde.
🎮 SIMULATION START
Variable:
30 % der Belegschaft drücken den Knopf nicht. Keine Pause, keine Stigma-Freiheit. Sie halten – aus Angst, unentbehrlich zu sein, aus Verantwortung oder weil der Job ihr letzter Anker ist.
Erwartetes Ergebnis (laut Abteilung „Stabilität“):
Die Standhaften retten das System. Ihre Loyalität stabilisiert, ihre Kraft wird gefeiert. Ein Triumph der Disziplin.
Simuliertes Ergebnis V1.0 (laut Abteilung „Erschöpfung“):
- Tag 1: 30 % halten durch, mit Stolz und Spannung. Die Pausierer werden beneidet, aber die Arbeit läuft.
- Tag 7: Erschöpfung schleicht ein. Manche brüsten sich, andere zählen die Stunden. Das System humpelt weiter.
- Tag 30: 15 % bleiben – die anderen sind ausgebrannt oder gebrochen. Die Überlebenden tragen die Last, aber der Sinn verblasst. Kollaps droht auch hier, nur langsamer.
SIMULATION PAUSIERT · ANALYSE AKTIVIERT
Analyse 2: Notstrom ist kein Betriebssystem
Die Standhaften sind nicht das Fundament, sie sind das Notstromaggregat. Ihre Energie – ob aus Pflicht, Angst oder Identifikation gespeist – verhindert den sofortigen Blackout. Sie verschafft dem System Zeit.
Doch ihr Opfer ist kein nachhaltiger Treibstoff. Es ist eine Ressource, die schwindet. Die Simulation zeigt: Ein System, das die einen verbrennt, um den anderen eine Pause zu gönnen, hat keinen Riss. Es ist der Riss.
Und hier beginnt das eigentliche Gedankenspiel:
Die Frage ist nicht: „Wie lange halten die Standhaften durch?“
Das ist nur Mathematik der Erschöpfung.
Die Frage, die uns umtreiben sollte, ist viel seltsamer:
Was, wenn genau diese Standhaftigkeit nicht das ist, was das System rettet,
sondern das, was seine notwendige Veränderung am längsten blockiert?
Könnte es sein, dass die wahre, konstruktive Störung nicht im Pausieren liegt, sondern im Loslassen der letzten, treuen Bastion?
Fußnote:
Manchmal ist die größte Loyalität, die man einem sinkenden Schiff erweisen kann, nicht zu bleiben –
sondern eines der ersten Boote zu besteigen, um zu zeigen, dass Land in Sicht ist.
Wer stehen bleibt, hält nicht nur die Stellung.
Manchmal hält er auch die Zukunft auf.