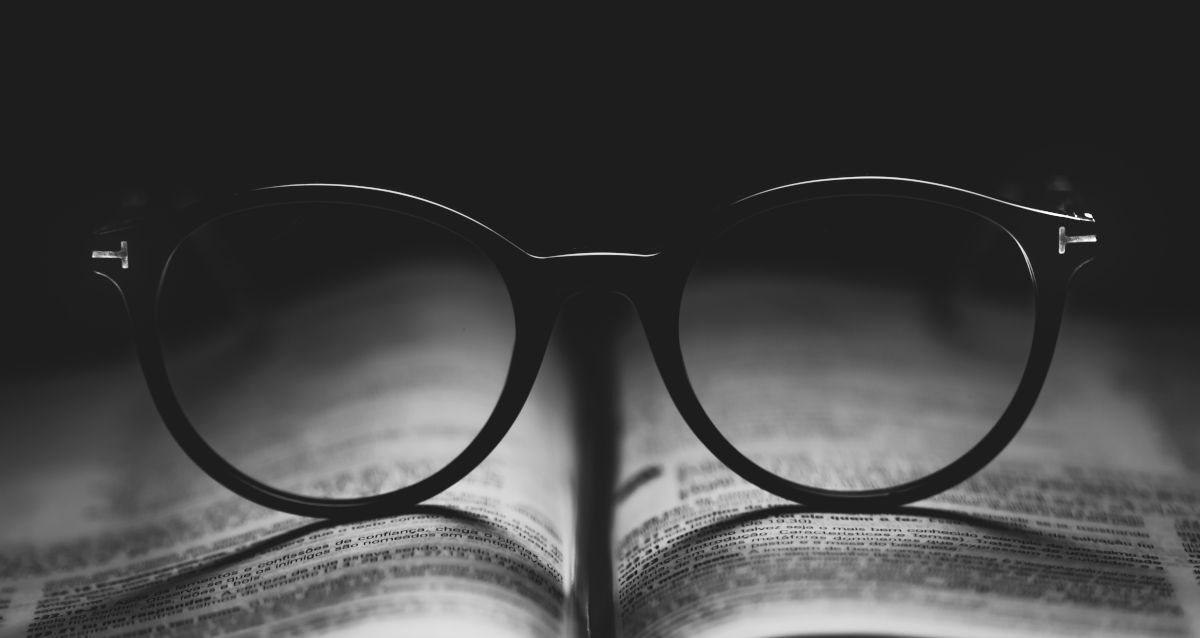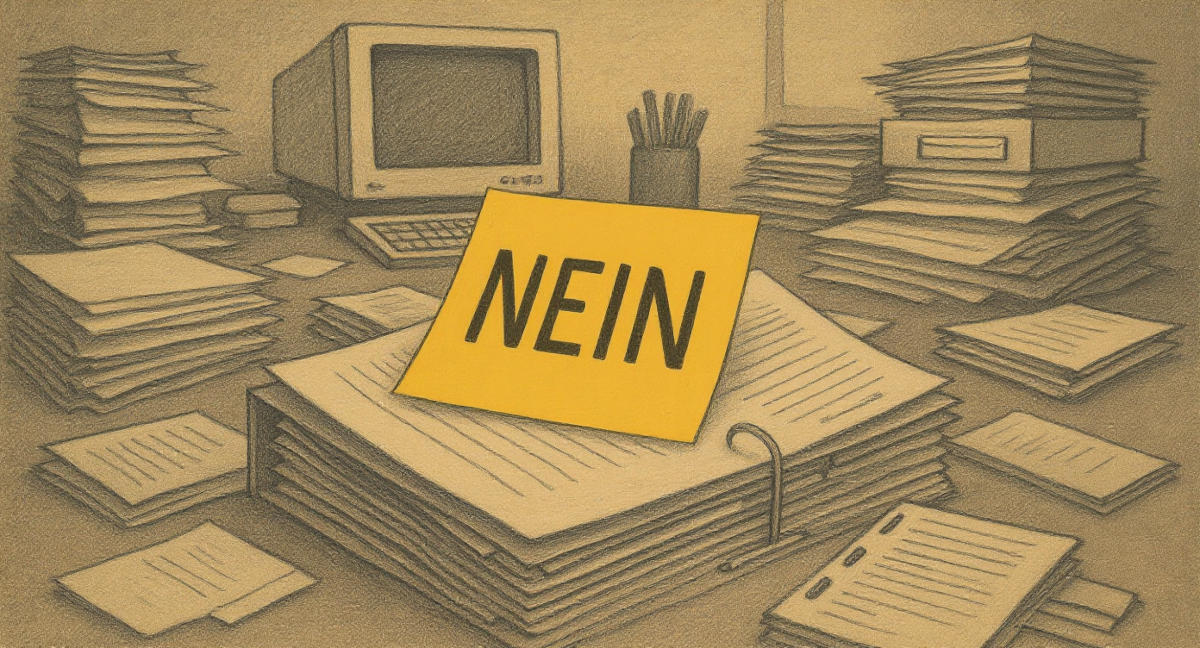
Service ≠ Servilität – Die Kunst des Nein-Sagens im Kundenparadies
Warum der kleine Gefallen oft der erste Schritt ins bodenlose Legacy-Chaos ist – und warum „Nein“ manchmal die beste Dienstleistung darstellt.
Die Ausgangssituation: Der Lockruf der Sirene (getarnt als treuer Kunde)
Man kennt das Szenario. Man hat seine Nische gefunden, die Prozesse optimiert bis zur Perfektion, die Dienstleistung X ist ein geöltes Uhrwerk. Man ist, kurz gesagt, der unangefochtene Meister seines kleinen, klar definierten Universums.
Und dann kommt ER. Der eine Kunde. Meist ein Guter, einer, der regelmäßig Aufträge bringt, vielleicht sogar einer, den man insgeheim mag. Er lächelt sein charmantestes Lächeln (oder schickt eine Mail mit extra vielen „liebschau“-Emojis) und säuselt: „Heyyy… du bist doch so unglaublich gut in X. Ich hätte da mal eine klitzekleine Bitte, könntest du für mich nicht vielleicht auch Problem Y lösen? Das ist doch bestimmt ganz ähnlich, oder?“
Dein Dienstleister-Herz macht einen kleinen Hüpfer. „Ein treuer Kunde! Eine kleine Abweichung! Leicht verdientes Geld! Was soll schon schiefgehen?“ Man ist ja schließlich Dienstleister. Die Betonung liegt auf DIENST. Also, warum nicht einfach... DIENST leisten?
System-Analyse: Warum „Nicht“ oft die bessere Antwort ist (eine Elegie an das Kerngeschäft)
Let me tell you why not. Und zwar in schmerzhafter, aber heilsamer Deutlichkeit. Denn jede gut gemeinte Abweichung von deinem sorgfältig kultivierten Core-Business hat das Potenzial, sich in einen ausgewachsenen, ressourcenfressenden Pain in the Ass zu verwandeln. Was kurzfristig wie ein Akt des Goodwills und ein Garant für ewige Kundenbindung aussieht, endet erfahrungsgemäß oft in einer der folgenden Sackgassen (oder allen gleichzeitig):
Die Neuerfindung des Rades (mit viereckigen Reifen): „Verwandt“ ist eben nicht „identisch“. Nur weil man eine Profi-Ausrüstung für Schwarzweiß-Druck besitzt und damit wahre Meisterwerke zaubert, ist man nicht über Nacht zum Experten für hochkomplexen Siebenfarb-Offsetdruck auf handgeschöpftem Büttenpapier geworden. Man fängt an zu basteln, zu improvisieren, zu recherchieren – und erfindet für diesen einen Spezialfall das Rad neu. Oft mit suboptimalem Ergebnis und enormem Zeitaufwand.
Die charmante Bastellösung (die keiner wirklich will, aber jeder sieht): Nach all dem Improvisieren und dem Ausloten der eigenen Grenzen liefert man dann oft eine Lösung ab, die zwar irgendwie funktioniert, aber eben nicht den eigenen Qualitätsstandards entspricht. Eine Art Frankenstein-Projekt – zusammengeschustert aus guten Absichten und mittelprächtigen Workarounds. Der Kunde ist vielleicht „okay damit“ (weil er keine Alternative hatte), man selbst ist latent unzufrieden, aber das eigene Firmenlogo prangt jetzt prominent auf dieser halbseidenen Extrawurst. Das kratzt am professionellen Ego – und potenziell am Ruf.
Der „Ach-wie-flexibel“-Stempel (Klebt wie Kaugummi – und schmeckt nach Burnout): Gratulation! Man hat nun offiziell den Ruf weg, „flexibel“ zu sein. Und zwar nicht nur bei diesem einen Kunden. Solche „Erfolgsgeschichten“ der unkonventionellen Problemlösung sprechen sich herum wie ein Lauffeuer in der Savanne. Die nächste Anfrage des ursprünglichen Kunden wird noch ein bisschen verrückter, noch weiter weg vom Kerngeschäft. Und er wird Freunde mitbringen! Freunde mit ebenso „kreativen“ Sonderwünschen. Man wird zum universalen Kummerkasten für alle Probleme, die auch nur entfernt nach der eigenen Expertise riechen.
Das ewige Dauerprovisorium (aka „Der Zombie im Keller“): Wenn die „kleine Gefälligkeit“ keine einmalige Sache war, sondern etwas von dauerhafter Natur (aber natürlich nicht systemkompatibel mit den Standardprozessen), dann hat man sich einen charmanten kleinen Fremdkörper ins Getriebe geholt. Ein halb-institutionelles Dauerprovisorium mit akuter Personengebundenheit. Etwas, das in keinem Pflichtenheft steht, das bei jeder Urlaubsvertretung und jedem Mitarbeiterwechsel (sofern überhaupt ein Handover für diesen Spezialfall stattfindet) wie ein rohes Ei behandelt und mit spitzen Fingern weitergereicht werden muss.
Exkurs: Das Ratten-Schwanz-Problem – Legacy-Chaos für Fortgeschrittene
Man hat vielleicht sogar noch sauber dokumentiert, was man da für diesen Spezialfall fabriziert hat. Aber die Dokumentation liegt in einem Unter-Unter-Ordner auf Server Z, dessen Existenz nur noch drei Eingeweihte kennen. Spätestens nach zwei, drei Job-Rotationen im Team (oder im eigenen Gedächtnis, falls man Solopreneur ist) wird dieses „kleine Projekt“ zur tickenden Zeitbombe.
Niemand weiß mehr wirklich, was da genau für ein Sonderdeal gemacht wurde, warum diese seltsame Insellösung existiert oder wie man sie pflegen soll. Sie liegt einfach da und fängt an, subtil vor sich hin zu stinken – bis sie irgendjemandem mit voller Wucht in den Allerwertesten beißt. Meist dann, wenn es am ungünstigsten ist. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben erfolgreich Legacy-Chaos geschaffen!
Die Zuckerspur zur Katastrophe
Wenn du eine einzelne Scoutameise in deiner perfekt sauberen Küche entdeckst, streust du ihr ja auch nicht noch demonstrativ eine Zuckerspur zum Vorratsschrank, oder? Eben.
Und mit Kunden, die mit immer ausgefalleneren Extrawünschen um die Ecke kommen, sollte man ähnlich verfahren. Klare Grenzen sind hier kein Zeichen von mangelnder Dienstleistungsbereitschaft, sondern von Professionalität und Selbstschutz (und dem Schutz des Kunden vor einer suboptimalen Lösung).
Außer natürlich, man hat sich explizit als „Das Extrawunschkonzert – Ihre Agentur für maßgeschneiderte Unmöglichkeiten“ am Markt positioniert. Dann aber bitte mit entsprechend horrenden Preisen, die den Aufwand für die ständige Neuerfindung des Rades und die individuelle Betreuung jedes Spezialfalls adäquat widerspiegeln.
Denn, und das ist die bittere, aber wichtige Wahrheit:
Service endet nicht bei der blinden Gefälligkeit
Manchmal erbringt man die allerbeste Dienstleistung, indem man freundlich, aber bestimmt „Nein“ sagt. Nein zu Projekten außerhalb der eigenen Kernkompetenz. Nein zu unrealistischen Erwartungen. Nein zu Lösungen, die am Ende niemanden wirklich glücklich machen.
Ein „Nein“ an der richtigen Stelle schützt die eigene Reputation, die eigenen Ressourcen und paradoxerweise oft auch den Kunden vor einer Enttäuschung. Standards sind sexy. Klarheit ist König. Und ein sauber definiertes Dienstleistungsportfolio ist der beste Schutz vor dem schleichenden Abdriften in die Servilitätsfalle.